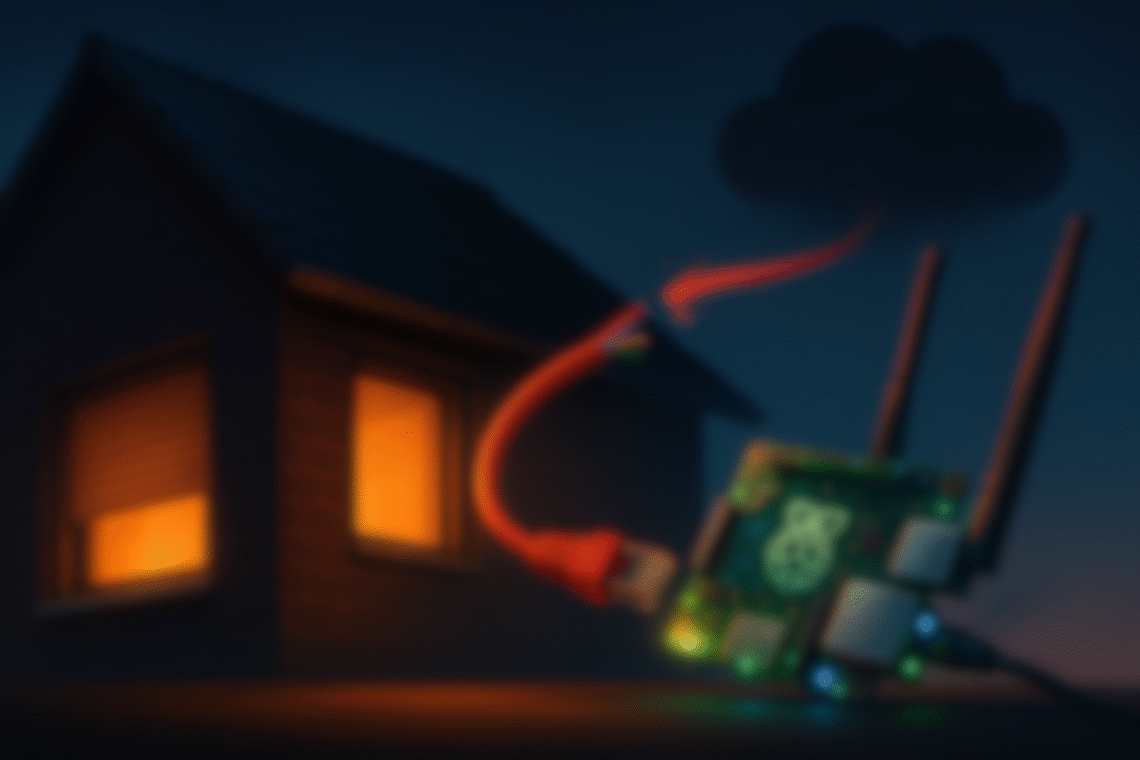
Hausautomatisierung ohne Cloud
Inzwischen hat ja wirklich jeder und seine Oma einen Artikel über Hausautomatisierung geschrieben – warum also noch einer aus meiner Feder? Die Antwort liegt im Fokus. Der überwiegende Teil der bisher von mir gelesenen Beiträge dreht sich um glänzende Komplettlösungen mit eigener App, Cloud-Anbindung und Alexa-Integration. Kurz: um alles, was ich bewusst vermeiden möchte.
Meine grundsätzliche Skepsis gegenüber Cloud-Diensten habe ich bereits an anderer Stelle beschrieben. An dieser Stelle soll es aber nicht um Datenschutz-Paranoia gehen. Natürlich erzeugt es kein sonderlich wohliges Gefühl, wenn chinesische oder gar US-amerikanische Anbieter Zugriff auf meine Heizungssteuerung haben. Und ja – aus meinem Heizverhalten, der Rollladensteuerung und den Startzeiten von Kaffeemaschine, Geschirrspüler oder Waschmaschine lassen sich Rückschlüsse auf meinen Tagesablauf ziehen. Eine wirkliche Bedrohungslage entsteht daraus jedoch kaum.
Viel relevanter sind zwei andere Themen: Resilienz und Obsoleszenz.
Resilienz der Infrastruktur
Hausautomatisierung soll zuverlässig funktionieren – auch dann, wenn die Internetverbindung ausfällt. Wer wie ich im digitalen Entwicklungsland Deutschland mit einem altrosafarbenen DSL-Anschluss lebt, weiß um die Realität: Jahrzehntealte Kupferkabel, nominell 100 MBit/s, praktisch schwankend und anfällig. Während man in Schweden Glasfaserleitungen bis tief in die Wälder verlegt, gilt hierzulande noch die Devise, dass man schließlich nicht an jeder Milchkanne Internet brauche. Vermutlich nicht mal an der Milchkanne in meiner Küche.
Wenn dann auch noch regelmäßig die Modemkomponente der Fritzbox durchbrennt, wird klar: Diese Infrastruktur ist kein stabiles Fundament.
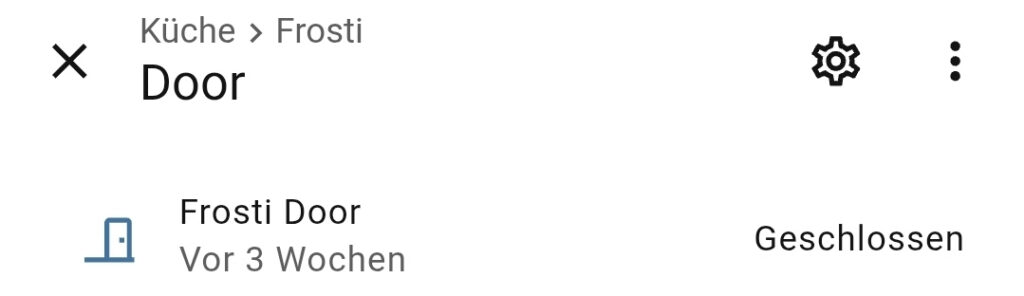
Das Problem zeigt sich im Alltag. Wir starten die App zur Rollladensteuerung, das Smartphone wechselt auf 5G, weil das WLAN zwar noch da ist, aber „kein Internet“ meldet. Die App öffnet sich, der Rollladen wird ausgewählt – doch nichts passiert. Der Server ist erreichbar, das Gerät in der Wohnung aber nicht. Mit der Heizungssteuerung sieht es nicht anders aus. Obwohl sich alle Komponenten – Smartphone, Router, Aktoren – innerhalb derselben vier Wände befinden, bewegt sich nichts. Nur der Kaffeevollautomat reagiert, sofern man nah genug steht, damit wenigstens eine Bluetooth-Verbindung zustande kommt.
Das alles in einer Umgebung, in der man ohnehin schon für jeden Vorgang eine eigene App benötigt. Hausautomatisierung, die auf diesem Prinzip basiert, erzeugt schnell mehr Frust als Komfort. Alexa & Co. helfen dabei übrigens auch nicht weiter: Ohne Internet sind sie ebenso stumm.
Das eigentliche Risiko der Cloud ist im Alltag also weniger die Frage nach Datensicherheit als vielmehr die Abhängigkeit: von einer unzuverlässigen Leitung, von Servern in Übersee und von der Langlebigkeit proprietärer Plattformen.
Obsoleszenz durch externe Abhängigkeiten
Damit sind wir direkt beim Thema Obsoleszenz. Cloudbasierte Systeme hängen zwangsläufig an ausländischen Servern. Sobald ein Unternehmen entscheidet, den Dienst aus Kostengründen einzustellen, hören die zugehörigen Komponenten auf zu funktionieren – unabhängig davon, ob die Hardware selbst technisch noch völlig in Ordnung wäre. Und dabei reden wir noch nicht einmal von Szenarien wie Embargos oder politischen Sanktionen.
Für die Nutzer bedeutet das im Klartext: hohe Investitionskosten für Geräte, die potenziell von einem Tag auf den anderen zu Elektronikschrott werden. Hier ein paar Beispiele:
- Logitech Squeezebox: Logitech stellte 2012 die Squeezebox-Reihe ein. Der Betrieb war stark an den Dienst mysqueezebox.com gebunden – mit der Folge, dass viele Geräte ohne diesen Zugang kaum noch sinnvoll nutzbar waren. Wer nicht selbst auf den lokalen Logitech Media Server wechselte, stand plötzlich mit wertloser Hardware da. (Heise)
- Google Nest / Works with Nest: Google hat die Plattform Works with Nest 2023 endgültig abgeschaltet. Zahlreiche Integrationen und Automationen funktionierten von einem Tag auf den anderen nicht mehr. Nutzer mussten auf „Google Home“ umziehen – sofern ihre Geräte überhaupt kompatibel waren. (Google Support)
- Apple HomeKit-Architektur: Apple treibt aktuell die Umstellung der HomeKit-Architektur voran. Ein Update auf die neue Plattform soll bald verpflichtend sein – ältere Hardware, die nicht kompatibel ist, verliert damit ihre Funktion. (Heise)
Und was heißt das im Alltag? Im besten Fall laufen einzelne Automationen nicht mehr zuverlässig: Rollläden reagieren verzögert und nur noch auf manuellen Tastendruck, die Heizungssteuerung fällt in einen lokalen Modus, der Akku für das Balkonkraftwerk meldet nur noch Fehler. Im schlechteren Fall sind ganze Gerätekategorien blockiert – und weil viele davon fest in der Wand verbaut sind, reicht es nicht, eine App zu deinstallieren oder ein Firmware-Update einzuspielen.
Im schlimmsten Fall lassen sich essenzielle Systeme gar nicht mehr bedienen: Heizungen bleiben auf einer fixen Einstellung hängen oder lassen sich bis zum Austausch der Hardware nicht mehr steuern. Rollläden fahren nicht mehr hoch oder runter, obwohl die Aktoren technisch einwandfrei sind. Und ein Energiespeicher, der ohne funktionierenden Cloud-Dienst arbeitet, lädt und entlädt sich im Zweifel nur noch aus dem Netzstrom – anstatt die selbst erzeugte Energie sinnvoll zu nutzen.
Das bedeutet nicht nur Komfortverlust, sondern echte Funktionsausfälle, die schnell teuer und unpraktisch werden. Der Elektriker muss kommen, Unterputz-Aktoren getauscht und im schlimmsten Fall Teile der Installation neu aufgebaut werden. Aus „praktischem Smart Home Komfort“ wird so ein Kosten- und Ärgernisfaktor, bei dem der Nutzer der Update-Laune und Geschäftsstrategie eines einzelnen Anbieters ausgeliefert ist.
Von den ersten Automatisierungen zu heutigen Zentraleinheiten
Oft existieren in Haushalten schon frühe Ansätze von Automatisierung – manchmal über Jahre gewachsen. Erste Lösungen gab es schon lange vor meinem eigenen Einstieg, etwa einfache Funksteckdosen oder proprietäre Heizungsregler. Ich selbst bin mit FS20 und der FHT80-Reihe eingestiegen – Systeme, die für ihre Zeit interessant waren, aber auch deutliche Schwächen hatten.
Ein wesentlicher Treiber für meinen späteren Wechsel lag in einem ganz praktischen Problem: den ständig leeren Batterien und Akkus. Verwendete man handelsübliche NiMH-Akkus mit 1,2 Volt, genügte oft schon eine moderate Temperaturschwankung, um die Spannung soweit abzusenken, dass das Gerät sie als „leer“ interpretierte. Klassische Batterien waren aus Umwelt- und Kostensicht keine attraktive Alternative. Auch der Versuch mit 1,6-V-NiZn-Akkus brachte keine nachhaltige Lösung – trotz hochpreisigen Spezialladegeräten lag die Gesamtlebensdauer nur knapp über der von herkömmlichen Batterien.
Mit Homematic und später Homematic IP kamen Systeme auf den Markt, die robuster funktionierten und erstmals den Sprung aus der Bastlerecke schafften. Damit begann die Hausautomatisierung, sich langsam von einem Nischenthema für Nerds zu einem Thema für breitere Nutzergruppen zu entwickeln.
Heute ist sie endgültig im Massenmarkt angekommen. Produkte wie die allgegenwärtigen IKEA-Lampen zeigen, dass Automatisierung längst kein Spezialthema mehr ist. Gleichzeitig führte diese Verbreitung aber auch direkt zur weiter oben bereits erwähnten Schwemme an Apps und Cloud-Lösungen: Jede Produktlinie bringt ihr eigenes Gateway und ihre eigene App mit, oftmals ohne Rücksicht auf Interoperabilität.
Das Ergebnis ist ein Flickenteppich: mehrere Gateways, parallele Apps und kaum gemeinsame Standards. Genau an dieser Stelle lohnt es sich, auf eine eigene Zentrale zu setzen – unabhängig von der Cloud, erweiterbar, und in der Lage, die verschiedenen Systeme wirklich zusammenzuführen.
Raspberry Pi als Herzstück
Als Schaltzentrale für die Hausautomatisierung bietet sich besonders ein Raspberry Pi an. Der kleine Einplatinenrechner vereint gleich mehrere Vorteile, die ihn fast zum Standard in diesem Bereich machen. Sein Stromverbrauch liegt selbst im Dauerbetrieb nur bei wenigen Watt und damit bei einem Bruchteil klassischer PC-Hardware. Durch die kompakte Bauweise – samt Gehäuse etwa so groß wie eine Zigarettenschachtel – verschwindet er unauffällig im Serverschrank, im Medienregal oder direkt neben dem Router. Auch preislich bleibt der Einstieg überschaubar: je nach Modell im zweistelligen bis unteren dreistelligen Bereich. Nach den pandemiebedingten Lieferengpässen sind aktuelle Varianten inzwischen wieder leichter erhältlich.

Hinzu kommt die enorme Schnittstellenvielfalt. USB, GPIO, HDMI, Netzwerk, WLAN und Bluetooth – kaum ein Gerät dieser Größe bietet eine vergleichbare Anschlussdichte und Flexibilität. Ebenso überzeugend ist die Softwarebasis: Für den Raspberry Pi existiert eine Vielzahl an Betriebssystemen und Spezialdistributionen, die ihn wahlweise zur Plattform für klassische Funksysteme mit CUL-Stick, für neuere Protokolle oder für Integrationssoftware machen.
Und meist bleibt sogar noch genug Rechenleistung übrig, um nebenbei weitere Dienste zu betreiben – sei es eine kleine private Homepage oder eine eigene Nextcloud-Instanz. Der Raspberry Pi steht hier stellvertretend für eine ganze Klasse von Geräten: kompakte, sparsame, aber leistungsfähige Kleinstrechner, die sich als Kommandozentrale im Eigenheim eignen.
Exkurs: Funkintegration am Raspberry
Ein Raspberry Pi allein ist noch keine Hausautomatisierung – seine Stärke liegt darin, sich mit der passenden Peripherie in fast jede Funkwelt einklinken zu können. Genau hier kommen die kleinen USB-Sticks ins Spiel, die dem unscheinbaren Rechner die Sprache älterer und neuerer Systeme beibringen.
Bei Homematic läuft normalerweise alles über die CCU („Central Control Unit“), die als Zentrale für Funkkommunikation und Logik dient. Wer die originale CCU3 kauft, bekommt eine eigenständige Box. Mit dem Raspberry Pi geht das aber auch günstiger: Der HmIP-RFUSB-Stick macht den Pi zur Homematic-Zentrale. Zusammen mit der Software RaspberryMatic entsteht ein vollwertiger CCU-Ersatz, der sowohl klassische Homematic- als auch Homematic-IP-Geräte unterstützt.
Daneben gibt es eine ganze Reihe spezialisierter Sticks für andere Systeme. Ein CUL-Stick (Busware CUL v3) erlaubt die Anbindung von FS20-Komponenten, den älteren FHT80-Heizungsreglern und auch Sensoren wie der KS300-Wetterstation, die im 868-MHz-Band funken. Ein JeeLink hingegen ist für diverse 433-MHz-Geräte geeignet, etwa für einfache Funksensoren oder manche Wetterstationen. Für IKEA-Trådfri-Leuchten wiederum existieren Zigbee-Sticks wie der ConBee II oder der Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle, die das IKEA-Protokoll verstehen und die Lampen lokal ansteuerbar machen.
Der entscheidende Vorteil: Nichts muss auf einmal erneuert werden. Alte FS20-Steckdosen im Wohnzimmer können neben einer KS300-Wetterstation auf dem Balkon weiterarbeiten. Gleichzeitig laufen modernere Homematic-IP-Heizungssteuerungen zuverlässig, und in der frisch eingebauten IKEA-Küche leuchten die Zigbee-gestützten Schrankunterlichter – alles unter einem Dach, ohne Cloud, und Schritt für Schritt erweiterbar.
So wächst der kleine Rechner nach und nach zu einer universellen Funkdrehscheibe heran. An einem einzigen USB-Hub hängen Homematic, FS20, Zigbee und andere Systeme nebeneinander – lokal gesteuert, ohne dass Daten an externe Server gehen.
Home Assistant als Schaltzentrale
So unterschiedlich die Welten von FS20, Homematic, Zigbee oder proprietären Herstellerschnittstellen auch sind – am Ende sollen sie sich aus Sicht des Nutzers wie ein einziges System anfühlen. Genau hier setzt Home Assistant an. Die Software läuft problemlos auf einem Raspberry Pi und bringt Treiber und Integrationen für hunderte von Protokollen und Geräten mit.

Ein zentrales Beispiel ist die Energiebilanz im Haushalt. Der APsystems EZ1-M Wechselrichter liefert im lokalen Modus die aktuelle Solarproduktion vom Balkon. Ein Shelly-Energiemessgerät erfasst gleichzeitig den Stromverbrauch einzelner Stromkreise oder des gesamten Haushalts. In Home Assistant laufen beide Werte zusammen – und das System erkennt sofort, ob gerade ein Überschuss erzeugt wird oder Netzstrom bezogen werden muss.
Solche Überschüsse ins Netz einzuspeisen, wäre technisch kein Problem – politisch ist das aber inzwischen kaum noch gewollt. Statt den Ausbau erneuerbarer Energien aktiv zu nutzen, setzt die aktuelle Energiepolitik weiterhin auf den Betrieb und gar Aufbau fossiler Kraftwerke. Für Kleinanlagenbetreiber bedeutet das: Einspeisung wird derzeit mit 0 Cent vergütet und es gibt ernsthafte Überlegungen, daraus künftig sogar Kosten für den Einspeiser entstehen zu lassen. Umso sinnvoller ist es daher, den eigenen Solarstrom direkt im Haushalt zu verbrauchen, anstatt ihn unentgeltlich oder gar mit Strafgebühr ins Netz zu leiten.
Die Konsequenz: Sobald Überschuss vorhanden ist, startet das System entweder gezielt weitere Verbraucher – sei es die Waschmaschine, der Geschirrspüler oder die Klimaanlage – oder es schaltet einen Speicher hinzu. Selbst wenn dieser mit eigenem Wechselrichter arbeitet und dabei Wandlungsverluste entstehen, ist das Ergebnis immer noch deutlich besser, als unter den aktuellen Rahmenbedingungen ins Netz einzuspeisen. Der Strom bleibt im eigenen Kreislauf, reduziert den Netzbezug und wird so optimal genutzt.
Auf dieser Basis lassen sich Automationen erstellen, die weit über simple Schaltuhren hinausgehen. Steht mehr Solarstrom zur Verfügung, als aktuell verbraucht wird, kann zum Beispiel die Klimaanlage noch einmal anlaufen. Statt bei 21 °C stehenzubleiben, wird dann eben auf 19 °C heruntergekühlt, damit die Energie nicht unentgeltlich eingespeist wird. Umgekehrt darf die Temperatur auch auf 23 °C ansteigen, wenn gerade die Waschmaschine läuft und der Verbrauch im Haushalt höher ist. So wird nicht nur Komfort, sondern auch Effizienz dynamisch gesteuert.
Das System lässt sich leicht ausbauen. Ein einfacher Funktaster kann signalisieren, dass der Geschirrspüler eingeräumt und startbereit ist oder dass der Akku des Elektrorollers am Ladegerät hängt und irgendwann geladen werden muss. Home Assistant entscheidet dann anhand der verfügbaren Solarenergie und der gerade aktiven Verbraucher, wann der beste Zeitpunkt dafür ist. Und sollte es doch einmal dringend sein, reicht ein Doppelklick auf den Taster, um dem System mitzuteilen: „Ich will JETZT laden.“
Auch moderne Küchengeräte von Siemens oder Bosch, die aktuell noch über Home Connect angebunden sind, lassen sich perspektivisch per API direkt ansprechen – ohne den Umweg über die Cloud. Damit erweitert sich die lokale Steuerung Schritt für Schritt, bis auch solche Geräte vollständig integriert sind.
Über die reine Geräteintegration hinaus bietet Home Assistant außerdem eine mächtige Dashboard-Funktion. Hier können nicht nur Sensorwerte und Schalter übersichtlich angezeigt werden, sondern auch externe Daten wie Kalendereinträge. So lässt sich beispielsweise eine kleine Signallampe am Mülltonnenkasten einschalten, wenn der Kalender anzeigt, dass morgen die Tonnen herausgestellt werden müssen. Auf dem Dashboard erscheint parallel ein Hinweis.
Dasselbe Prinzip funktioniert auch mit Alarmmeldungen. Statt dass der Kühlschrank nur intern piept, wenn die Tür zu lange offensteht, kann das Signal über Home Assistant auf eine generelle Warnlampe gelegt werden – ganz nach dem Motto:
„Hey, irgendetwas Wichtiges stimmt nicht, schau doch mal aufs Dashboard.“
So entsteht eine zentrale Übersicht, die nicht nur Geräte steuert, sondern den Alltag strukturierter, effizienter und ein Stück weit stressfreier macht.
Über die Wohnung hinaus
Hausautomatisierung endet nicht an der Wohnungstür. In einem Mehrfamilienhaus können sich die Konzepte noch einmal deutlich erweitern, wenn die technischen Voraussetzungen stimmen. Entscheidend ist dabei die Zählersituation: Gibt es einen gemeinsamen Hauptzähler für das Gebäude, lassen sich die Wohnungszentralen sinnvoll miteinander verknüpfen.
So kann die Zentrale von Wohnung 1 beispielsweise melden, dass gerade ein Überschuss besteht. Wohnung 2 verschiebt daraufhin automatisch bestimmte Verbraucher in genau diesen Zeitraum, sodass zumindest ein Teil des Stroms direkt im Haus genutzt wird. Läuft der Hauptzähler sogar unter null, signalisiert das dem System: Jetzt ist Strom im Überfluss vorhanden. Ein zentraler Speicher kann dann gezielt laden, anstatt dass der Überschuss ungenutzt ins Netz geht.
In dieses Modell fügt sich auch das Elektroauto nahtlos ein. Es wird nicht mehr nach starren Uhrzeiten geladen, sondern dynamisch: wenn Solarstrom vom Dach verfügbar ist oder wenn andere große Verbraucher gerade pausieren. Ebenso können Wärmepumpe und klassische Heizungsanlagen in die Gesamtlogik eingebunden werden, sodass sie Energie genau dann aufnehmen, wenn das Haus sie liefert.
Auf diese Weise entsteht innerhalb des Gebäudes ein intelligentes, kooperatives System. Dach-PV, Balkonkraftwerke, Speicher, Wärmepumpe, E-Auto und die einzelnen Wohnungszentralen arbeiten zusammen – und zwar lokal, ohne dass externe Cloud-Dienste die Koordination übernehmen müssen. Über die jeweiligen Zentralen sind damit praktisch alle Verbraucher im Haushalt Teil des Gesamtsystems: von der Waschmaschine bis zur Klimaanlage, vom Geschirrspüler bis zur Beleuchtung.
Ein zusätzlicher Mehrwert entsteht durch die statistische Auswertung der gesammelten Daten. Aus Lastprofilen, Wetterverläufen und Nutzergewohnheiten lassen sich Muster ableiten, die wiederum in neue Regeln übersetzt werden können. Mit jeder Iteration wird das System effizienter: Verbraucher starten noch passgenauer, Speicher werden optimaler genutzt, und die Energieflüsse im Haus lassen sich kontinuierlich verbessern. So wächst aus vielen einzelnen Automationen ein stetig verbessertes Gesamtsystem, welches sowohl Komfort als auch Nachhaltigkeit steigert.
Mit all dem sinkt selbstverständlich auch der Netzstromverbrauch aller beteiligten Haushalte – und damit drastisch die Kosten. Gerade in einem Abrechnungssystem, in dem sich der Strompreis am jeweils teuersten noch benötigten Lieferanten orientiert – in der Regel einem Gaskraftwerk – eröffnet sich hier ein überaus zukunftstaugliches Modell. Jede Kilowattstunde, die lokal produziert und verbraucht wird, entzieht sich dieser Logik und reduziert damit direkt die Ausgaben der Bewohner.
Warum ich so viele Netzwerkkabel verlege
Bis hierhin war viel von Funk, Gateways und Protokollen die Rede. Aber so praktisch diese Technologien auch sind – am Ende schlägt mein Herz für das Kabel. Wer mich kennt, weiß, dass ich bei jedem Renovierungsprojekt großzügig Netzwerkkabel einziehe, oft deutlich mehr, als auf den ersten Blick notwendig scheint.
Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist Kabel schlicht verlässlicher. Funknetze im 2,4-GHz-Bereich sind längst hoffnungslos überlastet: WLAN, Zigbee, Bluetooth und allerlei proprietäre Systeme konkurrieren um das knappe Spektrum. Dazu kommt, dass internationale Behörden in regelmäßigen Abständen Frequenzen neu vergeben – was heute noch Standard ist, kann morgen schon eingeschränkt oder gestört sein. Mit Kupfer in der Wand passiert das nicht.
Zum anderen ist Kabel planbar und langlebig. Echtes Kupfer überdauert Jahrhunderte. Dasselbe Material, das heute Gigabit-Netzwerke trägt, funktioniert im Kern unverändert seit Jahrzehnten. Man denke nur an den altrosafarbenen DSL-Anschluss, der bis heute über zweiadrigen Klingeldraht in die Häuser kommt – und trotzdem noch irgendwie funktioniert. Für moderne Netze setze ich natürlich auf ordentlich geschirmtes Cat7-Kabel, das auch in zwanzig Jahren noch State of the Art sein dürfte.
Vielleicht spielt hier auch ein Stück persönliche Geschichte hinein. In der DDR galt Kupfer als Mangelware – deshalb kamen verstärkt Al-Cu-Kabel oder gar reine Aluminium Kabel zum Einsatz. Dieser Mangel hat offenbar einen unstillbaren Hunger hinterlassen. Ähnlich wie bei den Bananen: So sehr ich mich an anderen Speisen „überfressen“ kann, bis ich sie nicht mehr sehen mag – Bananen gehen immer. Und Kupferkabel auch.
Fazit
Cloud ist und bleibt für die Hausautomatisierung die schlechteste aller Optionen. Sie mag kurzfristig bequem wirken, führt langfristig aber in Abhängigkeiten, die teuer, unzuverlässig und unnötig riskant sind. Die hier genannten Produkte sind keine Werbung, sondern schlicht Beispiele aus meinem eigenen Setup – gewachsen über viele Jahre, vom FS20-Aktor bis zur Zigbee-Leuchte, vom Shelly bis zum Wechselrichter.
Funk kann man machen, und in vielen Szenarien ist er durchaus praktisch. Aber wer Wert auf Stabilität legt, weiß: Kabel schlägt Funk in jeder Hinsicht. Ein ordentlich verlegtes Netzwerkkabel ist immun gegen überlastete Frequenzbänder, wechselnde Standards und die Launen internationaler Regulierungsbehörden. Kupfer überdauert Jahrzehnte, im Zweifel Jahrhunderte – und wenn schon heute DSL über zweiadrigen Klingeldraht läuft, dann kann man sich vorstellen, wie viel Potenzial in geschirmtem Cat7 steckt.
Natürlich weiß ich auch, dass es noch bessere Optionen gibt. Glasfaser ist in vielerlei Hinsicht die Zukunft – flexibel, leistungsstark und praktisch unerschöpflich. Nur ist diese Zukunft eben noch nicht ganz so universell und vor allem kosteneffizient einsetzbar. Irgendwann wird sie sich durchsetzen. So wie IPv6. Aber das erzählen wir uns ja auch schon seit über 20 Jahren.
Das könnte dich auch interessieren

Innovation vs. Stabilität
23. Februar 2024
Bitlocker gesperrt, was nun?
14. August 2024
